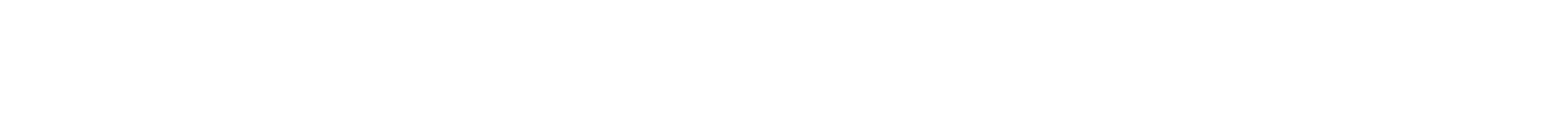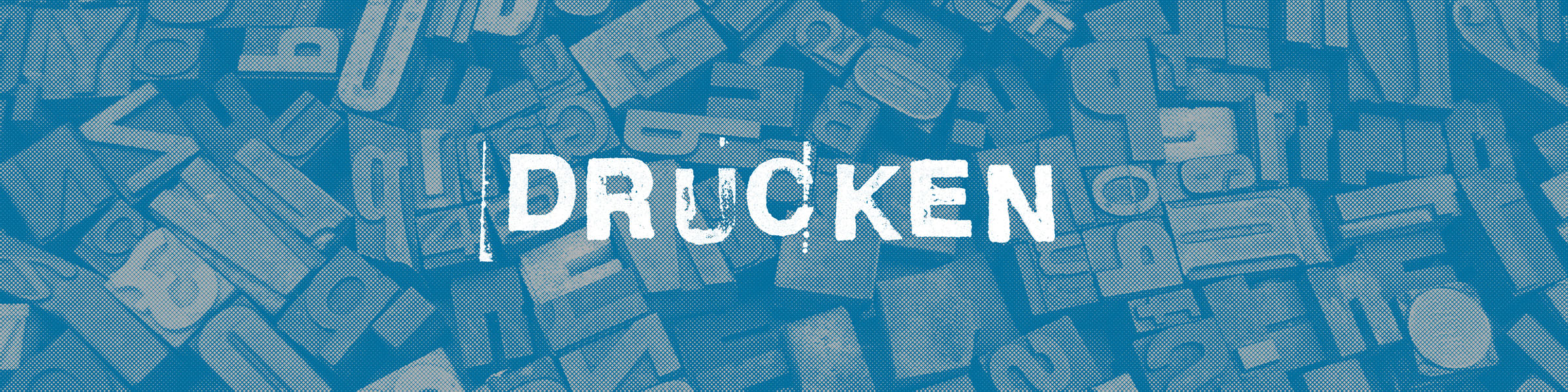
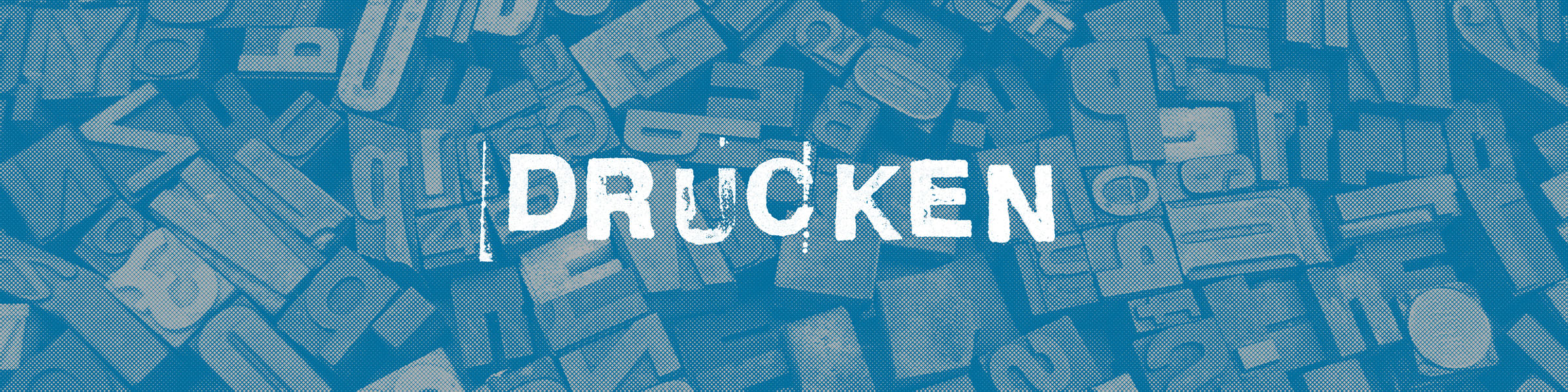
Die Liebe zur Typografie ist wie die Liebe zu Brot, Werkzeug oder anderen auf den ersten Blick profanen Dingen, die uns täglich umgeben, die wir nutzen, ohne sich dessen bewusst zu sein. Und die eher auffallen, wenn sie schlecht oder gar nicht funktionieren. Traditionelle Satz- und Druckarbeit ist heute ein Abenteuer, das nur noch wenige eingehen.
 Foto: Sonja Oetting
Foto: Sonja Oetting
Jede/r kennt das: es muss etwas im Haus repariert werden, das passende Werkzeug liegt nicht vor, es wird improvisiert und sich fest vorgenommen den Werkzeugkasten für das nächste Mal zu ordnen, aufzustocken oder wenigsten in Form zu bringen. Ein Vorsatz, der schneller vergessen ist, als die improvisierte Reparatur dauert. Dann ist man aber bei Profis zu Besuch oder hat mal Spezialwerkzeuge in der Hand, hat Zugang zu einem (semi)professionellen Hobbykeller, entdeckt coole Tools bei Freunden, dann erschließt sich einem plötzlich eine neue Welt. Man möchte teilhaben, will Details erkennen, Gebrauchsspuren wahrnehmen, Dinge verändern, reparieren oder gar mit eigenen Gerätschaften schöpferisch tätig werden. In der Küche, im Garten, am Schreibtisch, an der Werkbank. Oder man überlässt es anderen.
Die Typografie ist kein weites, sondern ein unendliches Feld, das uns aber oft nur von A nach B begleitet. Es gibt eine schier unendlich Fülle an Schriften, von denen viele sich in unterschiedliche Schriftgrade aufsplitten. Einige Unaufmerksame kennen neben den Regulären lediglich die Kursiven oder Fetten, dabei gibt es oft 10 oder mehr Abstufungen, die den GestalterInnen zur Differenzierung und Akzentuierung dienen: Heavy, Bold, Medium, Regular, Light, Extralight und so weiter lauten die Bezeichnungen, dazu dieselben Formen für die Kursiven oder Kapitälchen. Schaut man sich die einzelnen Zeichen einer jeweiligen Schrift an, so haben viele von ihnen besondere Details, die beim Lesen vielleicht gar nicht ins Auge fallen. Ein besonderer Q-Strich, ein elegantes R vielleicht, dessen Strich an anderer Stelle beginnt als üblich. Vielleicht eine Ligatur, einen Zusammenschluss zweier Buchstaben zu einer Einheit, der dazu führt, dass die kleine Kugel am Ende des kleinen Fs gleichzeitig ein I-Punkt ist. Eventuell ein elegantes »Kaufmanns-Und« das vom lateinischen et abgeleitet ist und sich bei genauer Betrachtung tatsächlich als eine Verschmelzung von E und T herausstellt. Ein J als Versalie, sprich Großbuchstabe, das wahlweise eine Unterlänge (wie der Kringel unter dem kleinen G) aufweist, oder sich aber genau in die Höhen der anderen Großbuchstaben einreiht.
Werden Schriften oder die Typografie im Detail schlecht gewählt, dann fällt es schnell auf. Sollte eine Telefonnummer schnell erfasst werden, aber man ist sich nicht sicher ob es jetzt eine 9, eine o oder eine 6 an der drittletzten Stelle war. Fällt uns eine Überschrift ins Auge, die beim ersten Lesen gar keinen Sinn ergibt, weil sie vielleicht nur in Versalien, nicht aber mit Gemeinen (Kleinbuchstaben) gesetzt wurde. Ist der (Schrift-) Grad zu klein, hat eine Zeile zu wenig Abstand zu der darüber liegenden, ist ihre Länge zu ausufernd und man verrutscht beim Lesen immer wieder in die falsche Zeile: es gibt viele Gründe warum ein Buch schlecht lesbar oder gar ermüdend sein kann und es liegt nicht immer an den AutorInnen oder ÜbersetzerInnen. Wo wir beim eingangs erwähnten Brot wären. Denn bei der Gestaltung von Büchern, oder anderen Erzeugnissen mit hohem Textaufkommen sprechen die GestalterInnen von sogenannten Auszeichnung- und Brotschriften. Erstere erklären sich von selbst, sie navigieren uns durch den analogen oder digitalen Kosmos. Letztere aber machen Strecke, tragen die eigentliche Information, so wie ein Brot eine leckere Auflage, einen sogenannten Brotaufstrich. Und wie dieses vielleicht auch zur Sättigung dient, transportiert die Brotschrift unsere Geschichte, den Roman oder das Gedicht, sie hält sich elegant zurück, ermüdet aber nicht. Aber nichtsdestotrotz soll sie ihre Schönheit haben, Spaß machen und pur genießbar sein.
 Foto: Sonja Oetting
Foto: Sonja Oetting
 Fotos: Blaukontor
Fotos: Blaukontor
Jede/r Frankreichurlauber kennt den Unterschied zwischen einem Baguette und einem hiesigen Kaviarbrot. Andererseits antworten die meisten Auswanderer auf die Frage, was sie von unserem Land am meisten vermissen: das Brot. Geht man jetzt einen Schritt weiter und verlässt den Computer, auf dem diese Zeilen geschrieben werden und wirft einen Blick auf antiquierte Satz- und Druckarten, dann wird ein Buchstabe zum Objekt. Vernommen haben es viele, dass früher von Blei- oder sogar Holzbuchstaben gedruckt wurde, vorstellen können es sich die wenigsten. Denn wie soll das gehen, dass die antiquarische Goethe-Ausgabe von einzelnen Buchstaben in Handarbeit zusammengesetzt und dann auf Papier gebracht wurde.
Die wenigen, verbliebenen Orte in Bremen, in denen man mit nicht mehr herstellbaren Schriften Druckerzeugnisse produziert, zeigen in kleinem Rahmen, was es früher für eine Arbeit war, große Textmengen zu vervielfältigen. Und verfügt man über eine solch rare Auswahl an Schriften, dann begreift man das Dilemma, das dieses Handwerk früher mit sich brachte. Denn während man auf seiner Tastatur ein und den selben Buchstaben unbegrenzt setzen kann, hat eine Bleisatzschrift selbstverständlich nur eine begrenzte Anzahl einer jeden Type. So wie sich beim Scrabble eben nicht allzu viele Worte mit einem X legen lassen. Und dann kann es sogar noch passieren, dass das vorhandene Material im Laufe der Zeit gelitten hat: Schrammen und abgestoßene Ecken, weggebrochene Serifen, nicht vorhandene Umlaute. Ganz zu Schweigen von der Tatsache, dass wir mit wenigen Klicks die Schriftgröße am Rechner verändern, im sogenannten Handsatz alles neu gemacht werden muss, wenn der Platz nicht reicht. Immer vorausgesetzt, dass die jeweilige Schrift überhaupt in unterschiedlichen Größen physisch vorhanden ist.
Traditionelle Satz- und Druckarbeit ist heute ein Abenteuer, das nur noch wenige eingehen. Das sich aber schon wegen seines Weges lohnt. Das eigentliche Ziel ist dabei nicht immer ausschlaggebend.