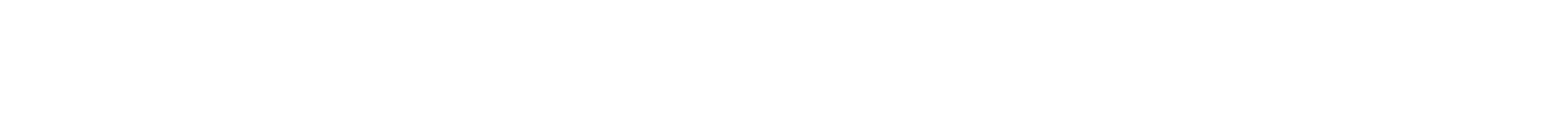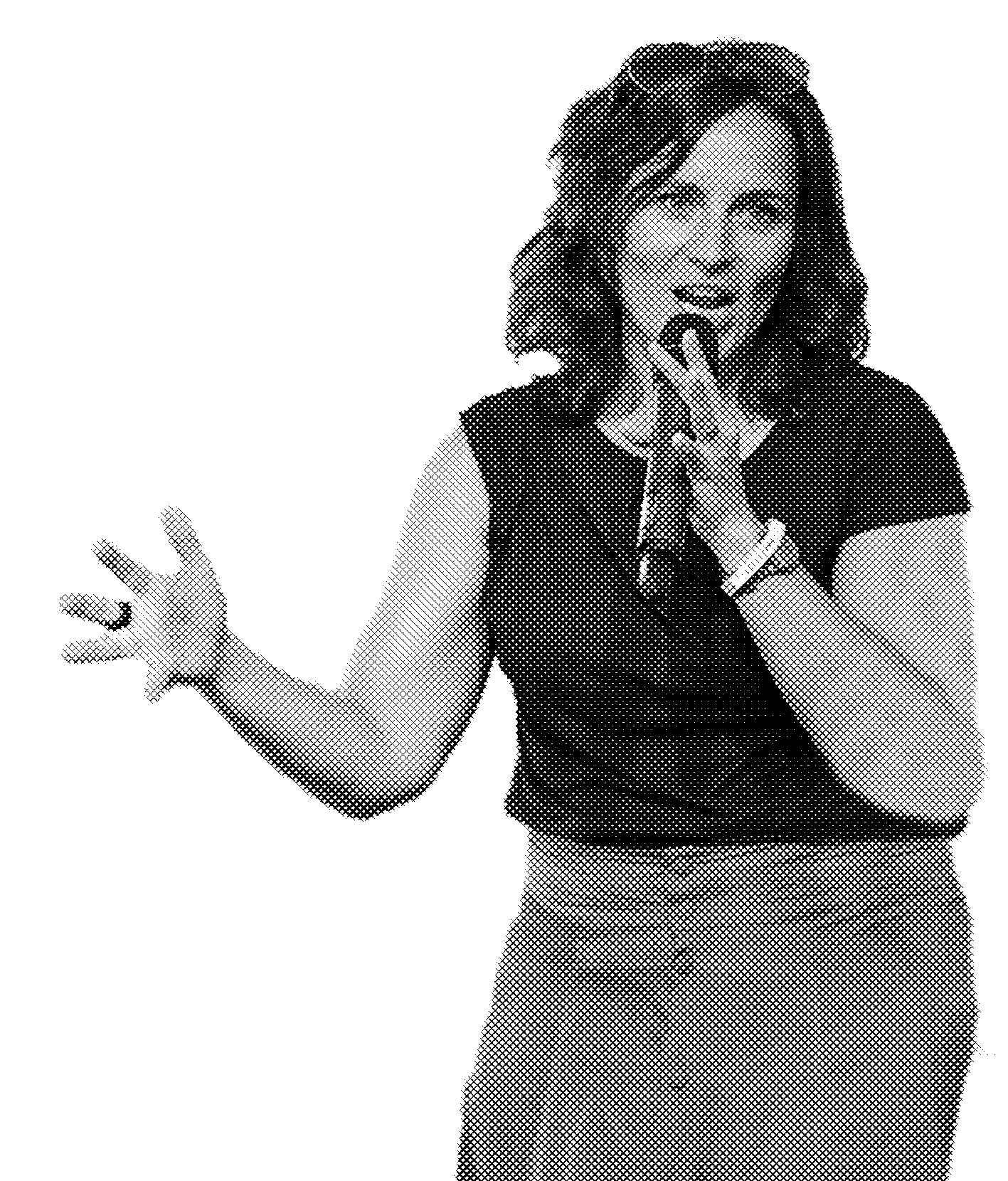
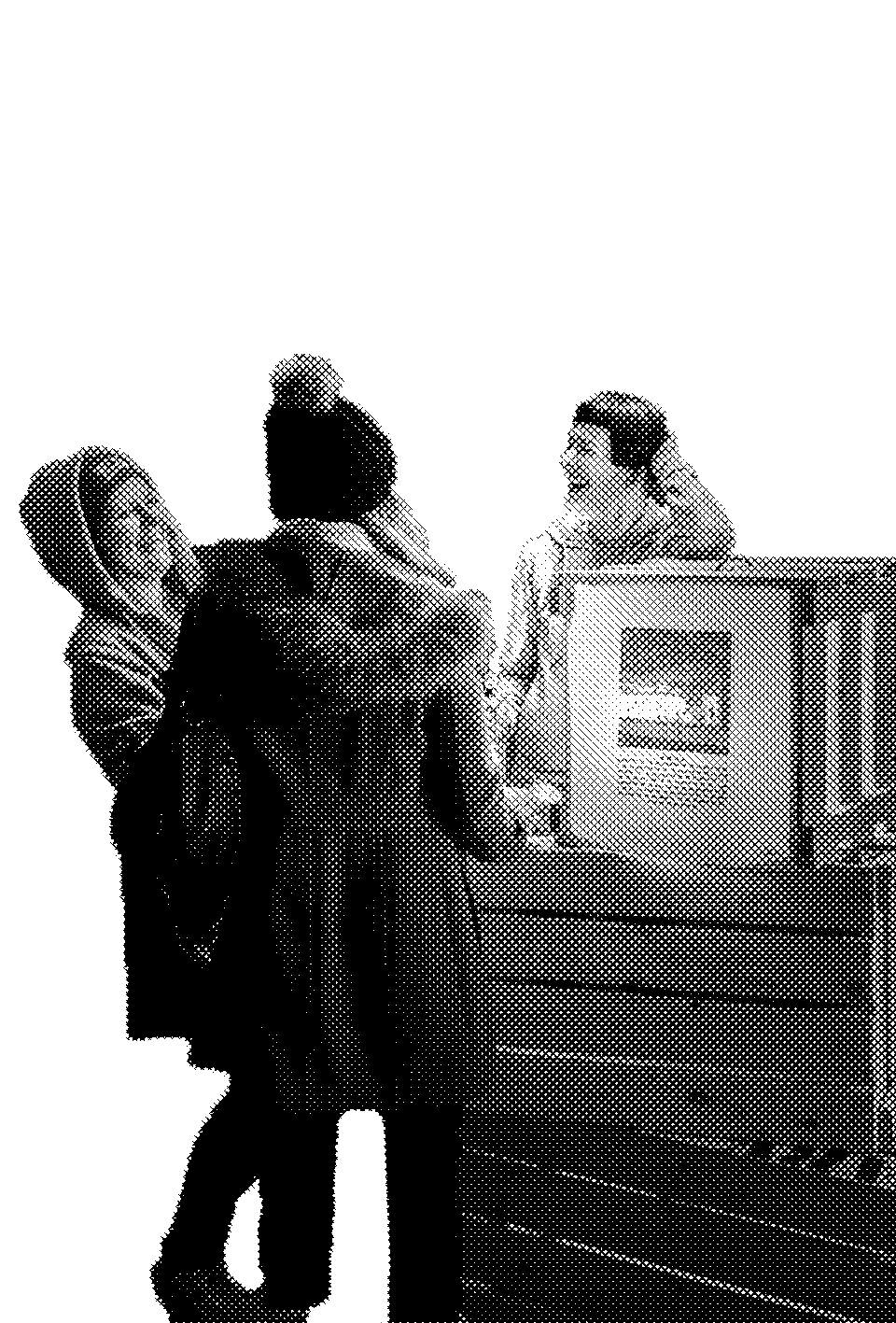

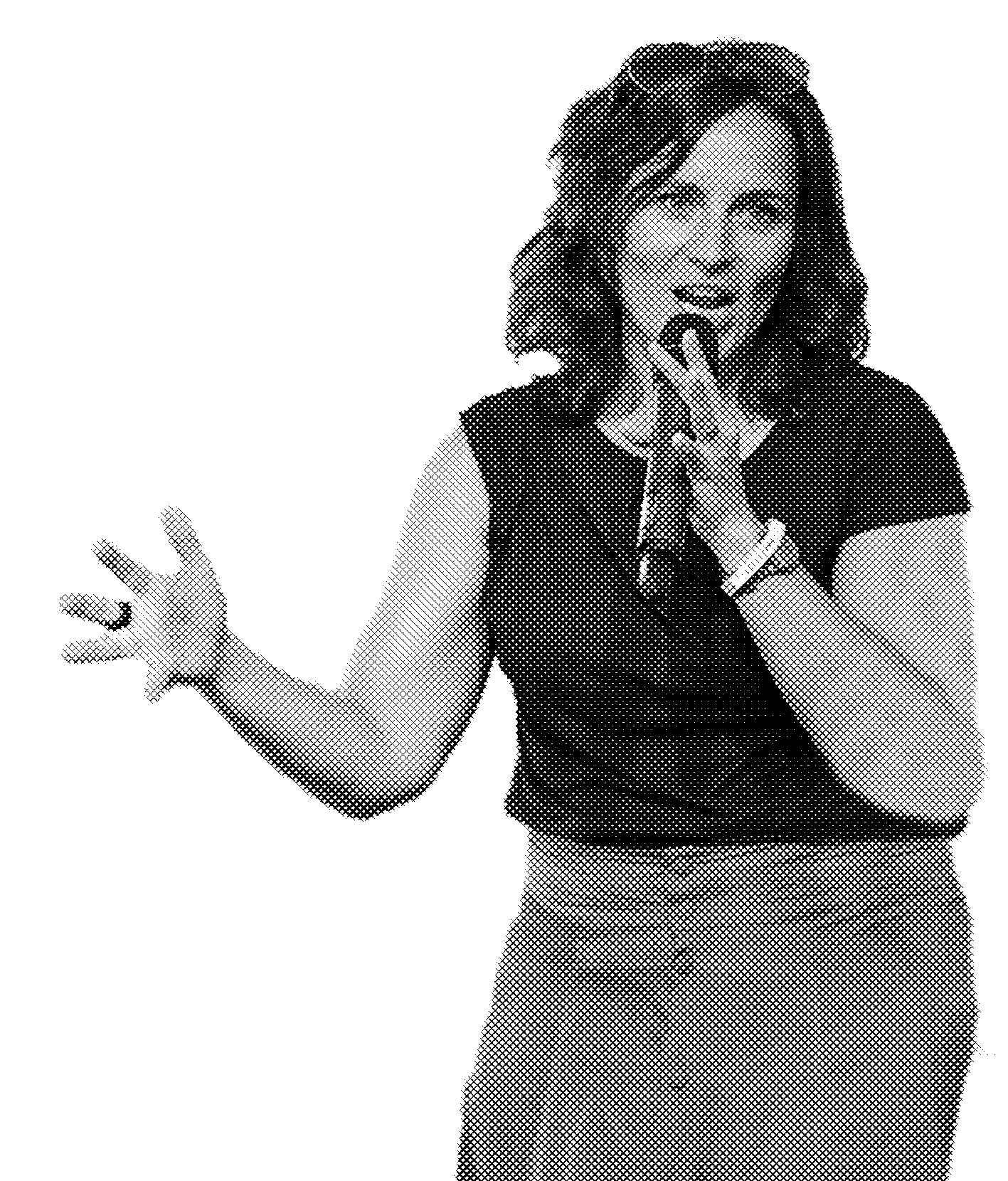
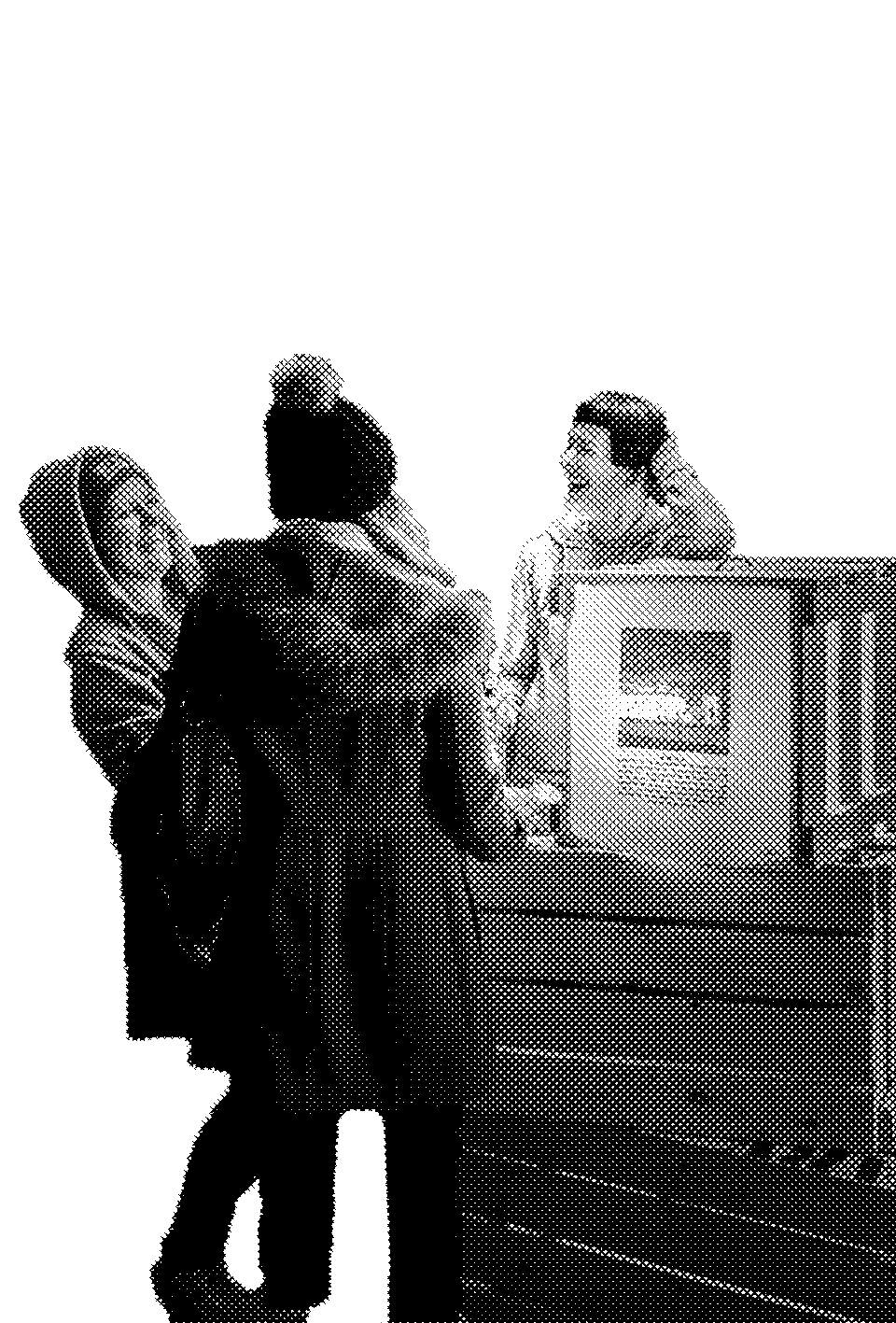
 @Tabea Horstmann
@Tabea Horstmann
Ein Freitagabend im Oktober. Draußen die Kleine Weser, drinnen der Klub Dialog und Gäste. Launige Begrüßung der Gastgebenden Manu und Hanke. Als Gesprächsgäste anwesend sind neun Frauen und zwei Männer sowie eine aufgeweckte Zehnjährige. Vom Klub Dialog tummeln sich noch weitere drei weitere junge Frauen sowie Leefje als Graphic Recorderin und icke als notierender Zaungast. Die Spitze der Alterspyramide führe geschätzt ich an, wenn auch nicht allzu einsam.
Eine Grundschülerin und viel Mittelalter, keine Teens, keine Senioren, keine Menschen mit Hinweis auf eine Herkunft außerhalb Deutschlands dabei. Man tut dem Publikum wahrscheinlich nicht unrecht, wenn man es auf deutsch, Mittelstand, Bildungsbürger zusammenfasst. So kann es gemütlich werden. Reibungskonflikte verschiedener Milieus sind nicht zu erwarten, die selbstbewusste Anwesenheit einer ostdeutschen Youtuberin und Mutter oben erwähnten Mädchens dürfte die extremste Eigenpositionierung des Abends sein.
Fünf Sitze bilden als Sprecher:innenplätze den Innenkreis der FishBowl, so nennt sich das Format des Abends. Drumherum sitzen gemütlich und zuhörend die anderen, die auf die Gelegenheit warten, jemanden aus dem Innenkreis abzulösen. Was jederzeit und ohne Limitierung passieren kann und soll. Im Hintergrund verfügen Manu und Hanke über eine Glocke und eine Gong, um nach Regeln, die hier nicht erläutert werden müssen, Schwung in die Runde zu bringen.
In der Mitte von allem eine Bowle-Schüssel, aus der Themenzettel gezogen werden, welche die Richtung der Diskussion rund um die Frage des Abends bestimmen sollen. Weil man den Gästen eine Hilfestellung geben will? Oder weil man der Frage in ihrer puren Form misstraut? Schwer zu sagen. Schauen wir uns die Frage doch erstmal näher an.
 @Leefje Roy
@Leefje Roy
Es gibt Fragen, die kommen einem verdächtig vor. »Können wir so bleiben, wie wir sind?« gehört ganz bestimmt dazu. Weil die Fragestellung bereits so viel vorwegnimmt. Und weil sie eine Erwartungshaltung in sich trägt, die man versucht zu entschlüsseln. »Können wir uns eigentlich verändern?« wäre eine Art gespiegelter Zwilling der Frage, der die These von Status und Veränderung umkehrt. »Dürfen wir so bleiben, wie wir sind?« würde den Aspekt des richtigen oder falschen Verhaltens zuspitzen. Das verallgemeinernde »Wir« lässt die Deutung offen, ob hier ein klarer Selbstbezug (Ich) enthalten ist oder eine Zuweisung an andere (Ihr). Also: Wer soll hier bleiben können, wie er, sie oder es ist?
Man fragt sich spontan: Hören wir da einen Vorwurf durch? Ist »wir bleiben so« eigentlich gut oder eher schlecht? Klingt irgendwie so, als wenn wir uns nicht genug verändern würden. Aber ist »wir verändern uns« per se gut, wenn nicht gleichzeitig die Richtung und das Ziel definiert wird? Wir befinden uns ja in einem zeitgeschichtlichen Kontext, in dem Veränderung, Optimierung und/oder Wachstum zur Grundphysik unserer Gesellschaft, unserer Wirtschaft und unseres Individualismus gehören. Gleichzeitig gehört das Bewahren oder auch das Konservierende sehr deutlich zu den Handlungsaufforderungen unserer Gegenwart, wenn wir an den Zustand unserer Welt denken. Das passt nicht zusammen, und dieses Spannungsfeld liegt in der Frage »Können wir so bleiben, wie wir sind?« wie ein kleiner Sprengsatz verborgen.
Zum Aspekt der Erwartungshaltung wiederum gehört der oder die Fragestellende: Wer fragt denn hier »Können wir so bleiben, wie wir sind?« Und welche Intention, welche Provokation steckt darin? Fragt hier eine moralische Autorität – mein Lehrer, der Bundespräsident, der Pabst – oder mein eigenes Gewissen.
Wir werden sehen: Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in der FishBowl lassen sich von solcherlei Sezierungen nicht irritieren und gehen forsch an ihre persönlichen Antworten heran. Soweit also läuft alles nach Plan

Die Gesprächsrunde beginnt mit einer Reflexion der Gespräche, die bereits im Vorfeld mit Ulrike Bensch und Sabine Doff geführten wurden. Es gibt jeweils einen Podcast dazu. Die beiden Frauen sitzen thematisch bereits vorgeglüht in der Runde und können so aus dem Vollen schöpfen. Ulrikes Antwort auf die Frage »Können wir so bleiben, wie wir sind?« fokussiert sich auf den Begriff »Hoffnung«. Das ist mindestens erklärungsbedürftig und wir hoffen auf Erläuterung. Bei Sabine bleibt die Gegenfrage »Warum?« stehen. Beide Antworten sind kein Zufall, wenn man genauer hinschaut: Ulrike ist Schriftführerin der Evangelischen Kirche Bremen, während Sabine als Professorin am Fachbereich Pädagogik der Universität Bremen lehrt. Um Goethe zu zitieren, was im Lauf des Abends noch öfter passieren wird: Das also ist des Pudels Kern.
»Selbst wenn wir so bleiben wollten, wie wir sind, könnten wir das nicht«, sagt Ulrike und beschreibt die Geschichte von Adam und Eva und dem Rauswurf aus dem Paradies als eine Erzählung vom Erwachsenwerden. Veränderung also als Unvermeidlichkeit – aber wie kommt es dazu? Sind es die Umstände oder sind es wir selbst, die wir mit unseren Handlungen die Veränderung initiieren?
Sabine bringt es auf die Formel »ABC = Attitude – Bevahiour – Consequences« (Infragestellung – Verhalten – Konsequenzen), was bezogen auf Ulrikes Paradies-Bild in etwa heißt: Da gibt es dieses seltsame Status-Quo-Gebot »Iss diesen Apfel nicht!«, dem wir die kindlichste aller Fragen, das »Warum?«, entgegenstellen. Mangels einer Antwort kommt es zum Verhalten, dem Konsum der verbotenen Frucht. Und natürlich hat das Konsequenzen. Den unparadiesischen Zustand unserer Welt haben wir uns also selber zuzuschreiben.
Immerhin, so der Zwischenschluss, wenn wir schon nicht so bleiben können, wie wir sind, dann haben wir die Veränderung wenigstens selber in der Hand. Ist aber auch kein Zuckerschlecken. »Mein Gott, müsste ich mich nicht noch viel mehr selbstoptimieren, um dabei zu bleiben?«, fragt sich Nadja, gibt dann aber die beruhigende Antwort: »Nein, muss ich nicht!« – Man könnte jetzt verwirrt sein: Was jetzt? Wir können also doch so bleiben, wie wir sind?
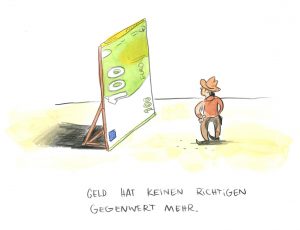
An diesem Punkt kommt die Bowle-Schüssel zum Zug und der erste Themenzettel wird gezogen: »Wirtschaft«. Mildred hat dazu ein Anliegen. Sie entwickelt ihre Frage, nicht ohne genussvolle Ironie, aus ihrer Herkunft – geboren in der DDR – und ihrer aktuellen Lebenswelt – arbeitet mit lauter konkurrenz- und statusfixierten Männern in einem marktwirtschaftlich orientierten Unternehmen. »Wie kriegt man das aus den Menschen raus, dass sich alle nur ineinanderknoten? Wie kriegt man es hin, dass alle zusammenarbeiten?« Das legt schon mal nahe, dass wir nicht so bleiben können, wie wir sind. Wobei nicht ganz klar ist, ob es »wir« sind, die nicht so bleiben können, oder »die anderen«.
Die FishBowl-Runde nimmt die nun folgende Kapitalismuskritik durchaus selbstreflektiert und selbstkritisch vor. Kerstin definiert Reichtum neu und stellt die These auf, dass sich »mehr« nicht nur auf Wirtschaft, sondern auch auf Dasein bezieht. Mehr Zeit, mehr Freiheit, mehr Sein. Denn: »Wo führt das klassische wirtschaftliche Denken hin? Und führt es dazu, dass wir uns wohlfühlen?«
Für Anselm liegt die besondere Tragik der Frage »Können wir so bleiben, wie wir sind?« in der Konfliktnatur des Menschen: »Wir lernen seit Jahrhunderten, dass wir etwas besiegen müssen, um weiter zu kommen.« Immer heißt Veränderung, etwas zu überwältigen, immer gibt es irgendwo einen Endgegner. Ein Mechanismus, der sich im Wachstumswettlauf des Kapitalismus fatal ausprägt. Wobei Mildred wiederum die positiven Aspekte im Wettbewerb sieht. Es ist halt im Menschen eingebaut, sich zu vergleichen. Und mit Druck und Konkurrenz geht Entwicklung schneller. Ergebnis: »Alle kriegen immer mehr. – Aber es ist auch völlig OK, wenn wir mal etwas ärmer werden.« Für Kerstin eine Frage der Definition: »Ist ärmer nicht vielleicht nur weniger?«
Die Themenrunde zu »Wirtschaft« endet mit dem Eindruck, dass wir die Frage »Können wir so bleiben, wie wir sind?« tendentiell mit Einschränkung, Verzicht und Verlust beantworten. Aber warum ist das so? Und muss das überhaupt so sein?
 @Leefje Roy
@Leefje Roy
Erster Exkurs zur Ausgangsfrage und wie man sie lesen kann, um gegebenenfalls eine Handlungsanleitung daraus zu entwickeln. Das Ganze soll ja zu irgendwas führen, dafür sollte der Adressat klar sein. Wir stellen fest: Es ist eine Frage der Skalierung des Subjekts, wie das »Wir« zu verstehen ist.
Da gibt es erstens den einzelnen Menschen, das Ich oder das Du, auf jeden Fall das Individuum. Vergleichweise klar zu erfassen als physische Einheit wie auch durch die zeitliche Begrenzung zwischen Geburt und Tod. Schwierig zu erfassen wiederum, weil sich im Begriff des Individuums der Aspekt der Individualität verbirgt, und die hat die Eigenschaft, sich Verallgemeinerungen zu entziehen.
Zweitens gibt es die Gesellschaft, die Gesamtheit aller zu einem Zeitpunkt X lebenden und handelnden Menschen. Also: Wir hier heute auf der Erde. Im utopischen Idealfall ist es eine global miteinander vernetzte Gesamtmenge an Menschen, die im simultanen politischen Austausch miteinander steht und als Gemeinschaft agieren könnte (ich sage nur: Alieninvasion!). In der Gegenwart sind wir davon noch weit entfernt, entsprechend skaliert sich das Kollektiv teilweise bis hinunter auf die dörfliche Gemeinschaft oder die Familie. Das ist schon deutlich schwerer zu erfassen, zumal in diese Gruppe ständig neue Mitglieder hineinwachsen und Teilhabe verlangen. Auch bezieht die Erfahrungswelt dieser generationenübergreifenden Gesellschaft zeitlich die Erlebnisse der jüngeren Vergangenheit und die Erwartung an die nähere Zukunft mit ein. Klingt vielleicht kompliziert, ist aber am Ende auch nur das, was Politik täglich leistet. – Oha!
Drittens schaut die Frage »Können wir so bleiben, wie wir sind?« auf die Menschheit gesamt. Und zwar in ihrer historischen Dimension seit Entstehung irgendwo im Quartär bis weit hinaus in eine zukünftige Entwicklung, soweit wir uns diese vorstellen können. Da stellen wir ganz schnell fest, dass uns die klare Abgrenzung, was Menschheit oder Menschsein ist und was nicht, entgleitet. Das ist aber auch egal, denn in dem Problem liegt bereits die Antwort: Nein, wir bleiben als Menschenart, als im engeren Sinne Homo sapiens, nicht so, wie wir sind. Wir sind ja nicht mal reine Homo sapiens, sondern im Genbereich zu einem Teil auch Neandertaler und Denisova-Menschen … und wer weiß was noch. Aber dazu später.
Betrachten wir zunächst die kleinste Einheit: den Menschen, das Individuum. »Kann ich so bleiben, wie ich bin?«
Selbstverständlich kann ein Neugeborenes, ein Kind nicht so bleiben, wie es ist. Wachstum und Entwicklung – nicht so bleiben können, wie man ist – sind die prägende Erfahrung der ersten Lebensjahre. Sie legen den Grundstein für einen unbekümmerten Wachstumsoptimismus, der in der Pubertät seine erste Trübung erhält. Es ist halt alles komplizierter, als es scheint. Der Wechsel von der Unbeschwertheit der Kinderjahre in die verwirrende Regel- und Pflichtenwelt des Erwachsenseins könnte für manche eine Traumatisierung sein, die zur Fragevariante führt: »Können wir nicht bitte, bitte so bleiben, wie wir sind – und einfach nicht erwachsen werden?« Peter Pan kann das.
Ewige Jugend. Vielleicht auch so ein Aspekt der Frage »Können wir so bleiben, wie wir sind?« Das wäre doch wünschenswert, im besten Alter, im Vollbesitz aller Kräfte, Sinne und Haare, so zu bleiben, wie man ist. Und die Menschheit hat auch archetypische Figuren dafür entwickelt: Götter. Wobei letztendlich auch die Erzählungen von Göttern und Göttinnen selten ohne Krisen, Veränderungen, Verfall und sogar Tod auskommen – weil es ein unmöglicher oder unerträglicher Gedanke zu sein scheint, wenn alles immer nur so bleibt, wie es ist. Vielleicht wären die nordische Edda oder die griechischen Göttersagen aber auch einfach nur langweilig ohne die Entwicklung ihrer Götterprotagonisten. Weshalb die Gottesfiguren der großen monotheistischen Religionen als Heldenfiguren nicht taugen.
Also, weiß das Individuum: Auf das Werden folgt das Vergehen. Der Tod steht am Ende. Wir können nicht so bleiben, wie wir sind. Wir können nichteinmal bleiben.
Bis diese Erkenntnis ihre lähmende Wirkung entfaltet – falls das überhaupt geschieht – gibt es für uns als Individuum jede Menge Anlässe und Gelegenheiten, nicht so zu bleiben, wie wir sind. Das Stichwort Selbstoptimierung fiel ja schon. Lebenslanges Lernen gehört auch dazu. Die Welt ist im Wandel – lebe den Wandel. Nichts ist beständiger als die Veränderung. Sich nicht zu verändern, so zu bleiben, wie man ist, ist ein kulturelles No-Go, nicht erst seit Berthold Brecht: »Ein Mann, der Herrn K. lange nicht gesehen hatte, begrüßte ihn mit den Worten: ›Sie haben sich gar nicht verändert.‹ – ›Oh!‹ sagte Herr K. und erbleichte.«
Dabei gibt es durchaus Gründe, so zu bleiben, wie man ist. Sich selber treu zu bleiben. Inneren Prinzipien wie Gerechtigkeit und Menschenwürde, aber auch Lebensfreude und Lust zu folgen, unabhängig von äußeren Anfechtungen. Großartig, wenn man das kann. Noch besser, wenn man die innere Stabilität fortwährend mit den äußeren Gegebenheiten abgleicht und Bleiben und Wandeln in einen klugen Ausgleich bringt. Was den Wandel sozusagen zum Status Quo macht.
Sofern das Zwischenfazit an dieser Stelle lautet, dass wir als Individuum schwerlich so bleiben können, wie wir sind, müssen wir uns fragen: Was genau »können« wir denn?
Und da muss man sagen, dass wir als Mensch weder besondere Möglichkeiten haben, so bleiben zu können, wie wir sind – noch, uns verändern zu können, wie wir sein wollen. Wir sind ausgestattet mit einem Gen-Set, das unsere Dispositionen – je nach Wissenschaftsmeinung – viel oder wirklich sehr viel festlegt. Wir werden in frühen Jahren sozialisiert von unserem Umfeld, das zudem nur ein winziger Ausschnitt des globalen Umfeldes ist. Unsere soziale Prägung ist also nie repräsentativ. Und es kommt noch schlimmer. Wir legen uns den Großteil unserer Fähigkeiten, Vorurteile und Routinen in den Jahren unserer Jugend zu, während wir gerade dabei sind, die Welt und ihre Regeln und uns selber mittendrin zu begreifen. Stichwort: Hormone und erste Liebe. Und dann die Enttäuschung in der Praxis. Wir erleben, noch während wir unsere Fähigkeiten im Erwachsensein erproben, bereits Disruptionen technischer und kultureller Art, die unseren kompletten Erfahrungsschatz auf den Kopf stellen. Im Grunde laufen wir dem Fortschritt ständig hinterher, manche können das gut, andere besser. Native User aber sind wir nur für die Technik und die gesellschaftlichen Konventionen von gestern.
Womit wir irgendwie beim Thema Bildung angekommen sind, was zum weiteren Verlauf des Abends passt.
 @Tabea Horstmann
@Tabea Horstmann
Die Glocke ertönt: das Zeichen zum Themenwechsel. Aus dem Topf mit den Themenzetteln wird »EU / Europäische Union« gezogen. Die Runde ist sich einige, dass man die Frage des Abends nicht zu diesem Stichwort bewegen möchte. Also erneut gezogen und heraus kommt »Schule«. Da werden die Gemüter wach, zu Schule kann jede was sagen. Also: Können wir so bleiben, wie wir sind?
Man ist sich zunächst weitgehend einig, dass das System Schule nicht so bleiben kann, wie es ist. »Schule in Deutschland ist das Paradebeispiel dafür, dass wir ganz viel Veränderung bräuchten, aber das ganz wenig passiert«, konstatiert Jules. Die meisten stimmen zu. Das Mensaessen steht in der Kritik ebenso wie das Curriculum generell und Goethes »Faust« im speziellen.
Hier wirft sich Sabine mit Verve in die Runde und widerspricht: Die Frage »Können wir so bleiben, wie wir sind?« sei exakt das, was in Faust I und II verhandelt werde. Und der Erfolg des Systems der deutschen Schule am deutschen Kind sei keine Frage des Systems: »Es liegt nicht am System. Das ist ein billiges Klischee. Wer will, der kann.« Das ist so elegant wie apodiktisch, dass die Runde es ignoriert.
Hier nun könnte die Frage des Abends ansetzen – zugespitzt auf: »Können wir selber so weitermachen, wie bisher?« – aber das tut sie nicht. Das System Schule bleibt im Fadenkreuz der Veränderungsforderung, auch wenn Sabine postuliert: »Schule ist ein bewahrendes System«, und Katrin die Herausforderung formuliert: »Wie können Kinder daran herangeführt werden, dass sie selbstbestimmt Lösungen finden?« Das immerhin ist ein Punkt! Die Runde in der FishBowl ist sich einig darin, wie toll es ist, dass sich viele junge Menschen in diesen Tagen politisch engagieren – Stichwort Fridays for Future.
Jules fasst es am Ende diplomatisch zusammen: »Ich bin für Bewahren, aber dafür muss man auch Raum für Veränderung geben.« Glocke – Themenwechsel.
Zweiter Exkurs. Es ist offensichtlich, dass die hier verhandelte Frage die Frage unserer Zeit ist. Erstmalig in der Geschichte der Menschheit berührt unser Verhalten – ob wir so weiterverfahren wie bisher oder ob wir einen neuen Kurs einschlagen – alle Menschen auf diesem Planeten und das gesamte System, in dem und von dem wir leben. Das »Wir« in diesem Fall ist nicht die Gesellschaft eines Landes oder eines Kontinents, so wie früher, als es darum ging, Fragen des menschlichen Miteinanders in Form von Krieg, Politik, Kultur, Wirtschaft und weiterem zu klären. Das Wir ist diesmal buchstäblich die gesamte menschliche Population. Weil die Auswirkungen unseres Verhaltens jeden Menschen in jedem Winkel dieser Welt betreffen werden. Weil wir es zu diesem Punkt haben kommen lassen. Tipping Point, Wendepunkt.
Wenn gefragt wird: »Können wir so bleiben, wie wir sind?« dann bezieht sich das »wie wir sind« auf unser Verhalten, das über Jahrhunderte ausgebildet wurde. Es geht um Konsum und Verbrauch, um ein Leben auf Pump in einer Welt, die so reich an allem ist, dass wir lange Zeit die Endlichkeit von allem und damit den Zeitpunkt der Schuldenfälligkeit nicht zur Kenntnis nehmen mussten. Es ist nicht so, dass uns die Begrenztheit zum Beispiel von fossilen Brennstoffen nicht bekannt gewesen wäre. Bereits in den frühen 1900er Jahren beschäftigten sich phantasievolle Schätzungen damit, bis wann die Steinkohlevorräte der Erde reichen würden. Aber das Problem war nicht akut, das Wissen löste kein Bewusstsein aus. Und niemand machte sich Gedanken über das, was wir beim Verfeuern der ganzen Kohle produzieren, nämlich CO2-Emissionen, und dass wir damit eine zweite Endlichkeit strapazieren: die Atmosphäre.
Der kritische Aspekt unseres Seins waren schon immer die Ressourcen. Die neolithischen Jäger jagten das Mammut, bis es keines mehr gab. Dann erfand irgendjemand die Tierzucht und das Problem schien gelöst. Wir denken, wir haben Einfluss auf unsere Ressourcen oder wir sind nicht von ihnen abhängig. Dieses Prinzip haben wir so groß gemacht, dass es ein Naturgesetz zu sein schien. Dieses Prinzip ist Teil unseres Wesens geworden. Und deshalb ist es richtig, dass die Frage des Abends nicht lautet: »Können wir weiter so handeln, …« sondern »Können wir so bleiben, wie wir sind?« Es ist unser Sein. Es sind wir.
In dieser Hinsicht ist das Subjekt der Frage die gesamte Gesellschaft aller heute und in naher Zukunft lebenden Menschen, weltweit. Sie sind das handlungsfähige und hoffentlich handelnde Subjekt.
Das Problem ist, das die Menschen noch nie besonders gut darin waren, sich als Ganzheit zu verstehen. Wir sind Individuen und wir können gut in Gruppen. Aber wir sehen immer auch »die anderen« und damit lässt sich jede unbequeme Verhaltensänderung leicht auf die andere Gruppe abwälzen. Sollen die sich doch ändern, dann können wir hier so bleiben, wie wir sind. Wenn die sich nicht ändern, können wir auch so bleiben, wie wir sind.
Es hilft nichts: Da wir als großes Kollektiv nicht handlungsfähig sind, müssen wir als Individuen handeln.
Aus der Bowle-Schüssel wird der Zettel mit dem Thema »Geld« gezogen. Jetzt wird es sozusagen persönlich. Mit dem Begriff Geld – oder auch: privater Wohlstand – betritt das persönliche verantwortliche Handeln die Runde. Mit Blick auf die zurückliegenden 16 Jahre – man könnte sie auch die Merkel-Ära nennen, was aber niemand tut – fragt Kerstin: »Ist unser Lebensstandard eigentlich noch angemessen?« Der Klimawandel steht ausgesprochen im Raum. Kerstins Beobachtung: Die Systeme, in und mit denen wir leben, waren starr und sind es immer noch, aber auch wir, die Menschheit, sind unbeweglich und behäbig. Hier nähert sich eine Antwort der Frage des Abends: »Können wir so bleiben, wie wir sind?
 @Tabea Horstmann
@Tabea Horstmann
Britta macht es kurz und bündig: »Die Entscheidung wird uns abgenommen. Ukraine, Gesundheit, eine Gesellschaft, die älter wird. Wir können gar nicht anders, als zu reagieren.« Woraufhin Asja die möglicherweise zauberhafteste Formulierung des Abends bringt: »Wo will ich hin? Jetzt, mit der Krise?« Da steckt so viel drin. Die Frage nach dem Ziel, nach der Richtung von Bleiben oder Veränderung. Die Fokussierung auf das Ich, die souverän handelnde Person. Und die Sicht auf die wahrgenommene Krise als Chance und Energie, vielleicht sogar als Partner. Denn »Krise« bedeutet ja genau genommen nicht einen schlimmen Zustand, sondern den Augenblick des Höhepunktes oder Richtungswechsels in einer meist dramatischen Entwicklung. Also: Veränderung und Aufbruch. Und warum nicht zum Besseren, wenn es vorher schon schlimm war.
»Können wir so bleiben, wie wir sind?« Jutta erklärt, warum sie die Frage spannend fand und warum sie jetzt, zum Thema Geld, in die Runde gekommen ist. »Ich habe darüber nachgedacht, wer ich überhaupt bin?« Die Aufgabe der Selbstklärung als Vorbedingung, um die Frage des so Bleibens oder des sich Veränderns beantworten zu können. Als erfolgreiche Unternehmerin kann Jutta auf ein Leben zurückblicken, das sich stringent aus Leistungswillen und dem klaren Bekenntnis zu Geld als Maßstab für Leistung entwickelte. »Ich habe alles …«, ist ein ungewöhnliches Bekenntnis an diesem Abend, das gleichwohl die Mehrheit der Anwesenden treffend abbilden dürfte, »… und plötzlich ist da so ein minimaler Riss reingekommen.« Wenn man nach dem Grund suchen würde, warum die Frage des Abends zu stellen ist, dann hat Jutta ihn hier ganz persönlich benannt. Vielleicht auch das stellvertretend für die meisten von uns Anwesenden.
Rückblickend jedoch ist nichts davon plötzlich: »Seit 1972 war das klar.« In der FishBowl-Runde fliegen die Worte im schnellen Wechsel. Der Klimawandel, seine Ursachen und seine Folgen – spätestens seit der wegweisenden Studie »Die Grenzen des Wachstums« des Club of Rome ist das alles bekannt. Aber es wurden zu wenig Schlüsse daraus gezogen, zu wenig Verhaltensänderung in gesellschaftlichem und auch persönlichem Maßstab fand statt. Geld und der Leistungsgedanke scheinen eine mächtige Kombination zu sein, die irgendwie für den Zustand der Welt verantwortlich ist. Anselm formuliert es mit dem Kulturanthropologen David Graeber: »Erst kamen die Schulden, dann kam das Geld«. Kerstin hinterfragt: »Wie machen wir das mit dem Leistungsgedanken?« – und von hier ist es nicht weit zum bedingungslosen Grundeinkommen, für das sich Britta und andere leidenschaftlich stark machen: »Das würde so viel bewegen!« Ein gesellschaftlicher Wandel, der die Rolle der beiden tradierten Mächte Geld und Leistung neu justiert. Nicht damit, sondern womit alles besser wird. Wirkung versus Ursache.
Nicht überraschend ruft das Widerspruch auf. Nadja schildert den Fachkräftemangel im Baugewerbe, wo selbst mit mehr Geld keine Leistung mehr einzukaufen ist, und fragt: »Wir schmeißen das alles über den Haufen – wie funktioniert das denn dann weiter? Ich sehe das Neue noch nicht.« Die Bereitschaft, für die Gesellschaft Leistung zu erbringen, sei nicht mehr vorhanden. Ihr Fazit: »Ich bin pessimistisch.« Das geht anderen in der Runde nicht anders, wenn auch mit anderen Beobachtungen der Gesellschaft.
Über die Idee des bedingungslosen Grundeinkommens werden sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Abends weder in der FishBowl noch beim daran anschließenden Wein wirklich einig. Immerhin ist das Thema für einige Anwesende eine klare Antwort auf die Frage des Abends. »Wie kommen wir zu einem neuen Wir?«, entwirft Kerstin eine Frage als Programm. Und auch sonst erblickt man Positives. »Es ist viel in Bewegung geraten«, resumiert Jutta. »Und da ist auch eine Chance drin.« Ihr persönliches Thema bleibt: »Wir müssen erstmal wissen, wer wir sind. Wenn wir das nicht wissen, wissen wir auch nicht, wo es hingeht.«
»Die Diskussion ist spannend«, sagt Sabine, »weil sie zeigt, dass jede Generation ihre eigenen Fragen hat. Das hier ist die Frage unserer Generation.«
Inzwischen ist der vom Programm gesetzte Schlusspunkt zeitlich bereits deutlich überschritten. Man könnte gefühlt noch stundenlang weiter, aber Manu und Hanke beenden mit dem Gong den offiziellen Teil der FishBowl. Hanke bringt die Idee der Veranstaltung auf den Punkt: »Irgendjemand hat gesagt: Reden hilft.« Nun geht es an die Bar, das hilft auch, wie der weitere muntere Verlauf der Diskussionen an diesem Abend beweist.

Exkurs Nummer Drei. »Woher kommen wir? Wer sind wir? Wohin gehen wir?« Paul Gauguins großes Gemälde aus dem Jahr 1897 stellt im Titel die großen Fragen, die uns sowohl als Individuum wie auch als Menschheit berühren. Unsere Herkunft, ob Garten Eden oder Ursuppe der Evolution oder unsere Familie, scheint uns mit einem Lebensauftrag zu versehen, der uns den Rahmen unseres Tuns setzt. Ob es nun das Verhängnis der Ursünde ist, das Naturgesetz des survival of the fittest oder das Vermächtnis unserer Eltern – wir stehen von Anfang an in einem Kontext, der die Antwort auf die Frage »Können wir so bleiben, wie wir sind?« lenkt und limitiert.
Dagegen grenzt sich die Frage, wer wir sind, als Akt der Autonomiegewinnung ab. Was sind wir ohne das, woher wir kommen? Nur wir im Hier und Jetzt. Für Mensch und Menschheit ist diese Suche gleichermaßen relevant. Denn nur wenn wir wissen, wer wir sind, können wir fragen, ob wir so bleiben können, wie wir sind. (Jutta betrat ja mit ebendieser Frage die FishBowl.)
Und egal, ob wir bleiben, wie wir sind, oder ob wir nicht so bleiben – wohin gehen wir damit? Mit welchem Ziel und zu welchem Nutzen oder Sinn? Sind wir damit auf dem Weg ins Himmelreich oder zu einem politischen Utopia oder zur ultimativen Familienversammlung im »Haus am See« a la Peter Fox? Der Weg ist das Ziel, soviel Plattitüde muss sein. Wir müssen unterwegs bleiben. Stillstand heißt nur in der Religion Erlösung, in der realen Welt heißt Stillstand Tod, Ende.
Kann die Menschheit so bleiben wie sie ist? Der Begriff der Menschheit beinhaltet das Mensch-Sein, und das simuliert eine Gewissheit über die Frage, wer wir sind, die im besten Fall trügerisch ist. Kurz gesagt: Wir, die Menschheit, konnten schon früher nicht so bleiben, wie wir sind, sonst wären wir gar nicht geworden, wer wir sind. Vor uns waren wir sowas Exotisches wie Australopithecus afarensis oder Homo erectus, ein bisschen was vom Neanderthaler und vom Denisova-Menschen ist – das hatten wir oben schon – auch immer noch in uns drin. Irgendwann zwischendurch erwies sich der aufrechte Gang für uns als gute Idee, dem folgte eine Vergrößerung des Gehirns und parallel dazu eine Verkleinerung der Kaumuskulatur. Vielleicht hat ja der feinkauende Genuss eine größere evolutionäre Bedeutung für die Entwicklung des Intellekts, als der Forschung bisher bekannt ist. Nur so eine Idee. Auf jeden Fall war die Sache mit dem Feuer ein Ding, das uns massiv nach vorne brachte – auch kulinarisch. Dem ging der fast vollständige Rückgang unserer primatischen Körperbehaarung voraus, was wiederum zu Kulturtechniken wie besagtem Lagerfeuer, Hausbau und 501-Jeans führte. Überhaupt hat uns unsere eigene Schlauheit über die Jahrhunderte verändert: Wir haben uns in die Abhängigkeit von bestimmten agrarischen Ernährungsformen begeben, was Sesshaftigkeit, Arbeitsroutinen und die Entwicklung von sozialen Organisationsformen förderte, aber auch die Ausbeutung endlicher Ressourcen mit sich brachte. Prägend war auch die Entwicklung einer Vorstellung von Besitz (von Dingen, Tieren und auch Menschen) und die Erkenntnis, dass man Besitz auch wegnehmen kann, zum Beispiel durch Gewalt. Das alles hat uns intellektuell wie moralisch verändert und prägt unsere Sicht auf die Welt.
Interessanterweise warf der Wechsel von der neolithischen Wildbeuterkultur zum Leben mit Ackerbau und Viehzucht die Menschheit sowohl in puncto Körpergröße wie auch Lebenserwartung erstmal zurück: Infektionen durch den engen Kontakt mit Tieren waren der Preis für die Versorgungssicherheit und die zahlenmäßige Ausbreitung. Demgegenüber stand ein kultureller und wissenschaftlicher Zugewinn, der mit Blick auf die vergleichsweise junge Geschichte der Menschheit atemberaubend ist. Der israelische Historiker Yuval Harari beschreibt es in seinem Buch »Homo Deus« etwa so: Von den Vier Apokalyptischen Reitern, die seit jeher die Menschheit dezimierten und einschüchterten, hat die Menschheit drei bereits überwunden: den Hunger, den Krieg und die Seuchen. Natürlich gibt es all das noch auf dieser Welt, aber es sind keine Naturgewalten mehr, denen wir hilflos ausgeliefert sind. Entweder liegt ihnen eine politische Entscheidung zugrunde, zum Beispiel durch Unterlassung, oder wir können diese Anfechtungen durch Wissenschaft und Technologie zügig einhegen. Harari entwickelte seine Thesen übrigens vor Corona und dem russischen Krieg gegen die Ukraine, aber die Entwicklungen bis zum heutigen Tag geben ihm eher Recht: Wir haben es in der Hand.
Offenbar ist es für die Menschheit keine Frage, ob sie so bleiben kann, wie sie ist. Sie will das gar nicht. Hararis These beschränkt sich entsprechend nicht auf die Überwindung von Hunger, Krieg und Seuchen – er sieht es als gegeben, dass die Menschheit auch den vierten Apokalyptischen Reiters überwinden will: den Tod. Ironie der Aussicht: Das ist dann wohl der Zustand, wo man auf Dauer bleibt, wie man ist.
Ein wirklich neues Denken, ein neues Selbstverständnis der Menschheit kommt bei sowas nicht heraus. Man hat die Ahnung, dass es allenthalben viel Sattheit gibt und den Wunsch nach mehr vom Gleichen. Die Frage »Können wir so bleiben, wie wir sind?« als verstetigte Infragestellung zu verstehen, wäre die Herausforderung. Dazu gehört wohl auch ein Leiden am Heutigen, aber anders als Fausts Mephisto, »der Geist, der stets verneint! Und das mit Recht; denn alles, was entsteht, ist wert, dass es zugrunde geht«. Vielmehr ein Leiden mit der Erwartung, dass ein Aufbruch in der Luft liegt und dass ein lohnendes Ziel wartet. Wann gab es zuletzt Utopien, die sich was trauten?
Friedrich Nietzsche war so jemand, der am Zustand der Welt litt und großes Neues dachte. Peter Neumann schreibt in DIE ZEIT: »Nietzsche fühlte sich erdrückt und wollte Platz schaffen für etwas radikal Neues. Und auch wenn er kein gutes Haar an seinen Mitmenschen ließ, so war sein Denken doch von einer großen utopischen Kraft durchdrungen. Alles sollte anders werden. Die Gesellschaft, und am besten auch gleich der Mensch.« Sein Übermensch-Konzept beinhaltet zweifellos Entgrenztes und Fragwürdiges, aber die Konsequenz seines Denkens ist bestechend, wenn es um die Frage »Können wir so bleiben, wie wir sind?« geht. Der Philosoph Rüdiger Safranski zeigt als positive Seiten des Übermenschen auf: »… er ist aber auch ein Ideal für jeden, der Macht über sich selbst gewinnen und seine Tugenden pflegen und entfalten will, der schöpferisch ist und auf der ganzen Klaviatur des menschlichen Denkvermögens, der Phantasie und Einbildungskraft zu spielen weiß. Der Übermensch realisiert das Vollbild des Menschenmöglichen, und darum ist Nietzsches Übermensch auch eine Antwort auf den Tod Gottes.«
Geht’s noch größer? Lohnt es sich, den Gedanken weiterzuverfolgen, wohin es die Menschheit evolutionär führen mag, wenn wir feststellen, dass sie nicht so bleiben kann, wie sie ist? Werden wir uns mittels Technik optimieren zu Cyborgs oder transformieren zu digitalen Entitäten in einer Meta-Matrix? Bleiben wir Individuen oder werden wir zu einem technisch vernetzten Kollektiv? Ist es dann überhaupt noch eine Menschheit, wenn sie nicht mehr aus Menschen wie wir besteht? Die Frage führt Lichtjahre in die Zukunft oder in einen Kaninchenbau.
Die ambivalente Antwort: Panta rhei – alles fließt. Nichts kann so bleiben, wie es ist, wenn alles bleiben soll, wie es ist.
Mit einer Ausnahme. Und die ist bezeichnend, weil sie unser Sinnbild für Schönheit und Unvergänglichkeit gleichzeitig ist. Also nahezu Perfektion. Shirley Bassey: »Diamonds are forever.«
 @Tabea Horstmann
@Tabea Horstmann
Man hatte mir gesagt, ich dürfe die Klub-Dialog-Veranstaltung zu dem Thema »Können wir so bleiben, wie wir sind?« textlich so verarbeiten, wie es mir in den Sinn kommt. Entsprechend habe ich mir Freiheiten genommen, die dem Wunsch nach einer vollständigen Dokumentation vielleicht nicht entsprechen, obwohl ich versichern kann, dass alle Wortbeiträge tatsächlich so gesagt wurden und der Abend weitgehend so verlief, wie geschildert. Daneben enthält der obige Text eine Betrachtungsebene – die drei Exkurse –, die mit dem Gesagten an dem Abend recht wenig zu tun hat. Das schien eine ganz gute Idee zu sein, birgt aber auch Risiken. Ich hoffe, der unterhaltsame Wert überwiegt.
Im Vorfeld habe ich mich zudem mit der Bitte um kluge Gedanken an eine bunte Auswahl befreundeter Menschen gewandt. Sie kannten nur die Frage, nicht den Kontext. Wer Zeit hatte, hat geliefert. Einige der Gedanken haben mich, wie ich zugeben muss, überfordert – und zwar insofern, als dass sie zu tollen, aber komplett eigenständigen Reflexionen des Themas geführt hätten, die nicht meine waren. Daher habe ich mich auf die sorgsame Entnahme einzelner Ideen und Bilder beschränkt, die ich aus formalen Gründen nicht kennzeichnen kann. Daria, Emma, Heiko, Matthias – habt Dank für Eure großartigen Anregungen!
(Bremen im November 2022)

Du möchtest noch mehr zum Thema? Dann hör unbedingt in unseren Podcast rein! Hier geht’s lang.