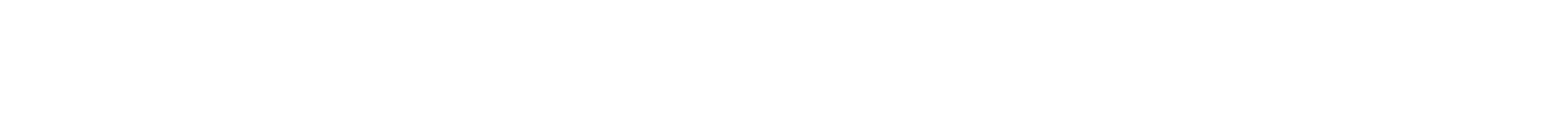Rainer Kresken sieht unauffällig aus: grauer Dreitagebart, wenig Haare und das Hemd akurat in die Hose gesteckt. Man ist schon geneigt leicht zu gähnen – bis er anfängt zu reden. Plötzlich verwandelt sich Rainer Kresken in einen Visionär der besonderen Art. Mit gestrecktem Finger zeigt er in Richtung der Decke und meint damit aber nicht die Zimmerdecke, sondern er will höher hinaus – viel höher.
Er erzählt von der Möglichkeit, mit einem Aufzug ins All zu fahren. Diese Vision lässt einen im ersten Moment die Kinnlade runterklappen, doch er erzählt einfach weiter. Laut Kresken, der als Ingenieur für den Betrieb von Forschungssatelliten am Europäischen Raumflugkontrollzentrum in Darmstadt arbeitet, ist dieser Traum aber gar nicht so weit weg, wie man im ersten Moment annimmt.
So erzählt er dem Fachpublikum im Mai 2017 auf der re:publica in Berlin folgendes: „Der physikalische Schlüsselpunkt ist, dass der Endpunkt des Aufzuges in den geostationäre Orbit geschossen werden muss. Es muss ein Gegengewicht geben und unter Nutzen der Erdrotationskraft kann der Aufzug dann noch oben fahren.“ Als Startpunkt könnte laut Kresken eine Art Ölplattform im Meer dienen, die idealerweise am Äquator liegen sollte und in guten klimatischen Bedingungen.
Der Raumfahrt-Ingenieur und Amateur-Astronom glaubt daran, dass es irgendwann soweit sein wird. Der große Vorteil wäre, dass man keine Raketen mehr bräuchte. Die Vorteile liegen nach Rainer Kresken auf der Hand: „Der Weltraumaufzug wäre im Endeffekt kostengünstiger, energiesparender und ist wiederverwendbar.“ Die Idee tauchte schon um 1895 bei Konstantin Ziolkowsky auf, der schon ähnliche Ansätze hatte. Bis heute fasziniert es viele Physiker und taucht auch in der Literatur hin und wieder mal auf: Der Sci-Fi-Autor Arthur C. Clarke schrieb 1979 in „The Fountains of Paradise “ über eine solche Konstruktion und welche Probleme und Vorteile sie mit sich bringt.

Für Rainer Kresken ist das einzige und entscheidende Problem, welches die Wissenschaft ernsthaft an einer Umsetzung hindert, die Reißfestigkeit des Materials. Das Seil für den Aufzug muss eine enorm hohe Reißfestigkeit haben – mindestens 5000 Kilometer muss es sein Eigengewicht halten können ohne zu reißen. Legierter Stahl schafft um die 1000 Kilometer – noch lange nicht genug.
Es gibt jedoch Hoffnung, denn es wurde ein Stoff gefunden, der sogar über 10.000 Kilometer Zugfestigkeit hat: Kohlenstoffnanoröhren. Das Problem ist hierbei, dass im Labor bisher nur wenige Zentimeter von dem Material hergestellt werden können. Kresken meint dazu: „Mindestens bräuchte man einige Meter, dann könnte man das Material miteinander verknüpfen.“
Am Zentrum für angewandte Raumfahrttechnologie und Mikrogravitation (ZARM) der Bremer Universität ist man da ein wenig vorsichtiger, wenn es um das Thema Weltraumaufzug geht: „Es ist eine ganz tolle Idee und wünschenswert in der Umsetzung. Nur sehen wir eine Umsetzbarkeit in naher Zukunft nicht. Da es nicht nur das bereits beschriebene Problem des Materials gibt, sondern es technologisch auch erst einmal möglich seien muss, solch hohe ‚Gebäude‘ zu errichten. Dabei spielt natürlich nicht nur die Höhe eine Rolle, sondern auch die Masse, die bewegt werden muss. Denn damit das ganze ‚Gebäude‘ nicht umfällt, muss die selbe Masse im Geo-Orbit noch einmal befestigt werden, damit sozusagen ein Zug entsteht, der das ganze ‚Gebäude‘ stabil macht.“
Also alles noch Zukunftsmusik? Rainer Kresken antwortet auf die Frage, ob er den Weltraumaufzug noch erleben wird: „Das hängt ganz entscheidend an dem Fortschritt der Technik und ob das Material für das Seil des Aufzugs hergestellt werden kann.“
Bild: Freigegeben unter CC0 Creative Commons License via Pixabay.